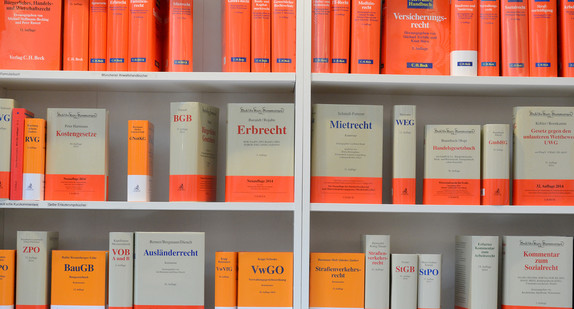Zur Bearbeitung der Diesel-Verfahren ist am Oberlandesgericht Stuttgart ein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Assistenzsystem eingeführt worden. Dieses soll die Systematisierung der elektronischen Verfahrensakten nach immer wiederkehrenden Merkmalen übernehmen, um Richterinnen und Richter zu entlasten.
Am Oberlandesgericht Stuttgart ist zur Bearbeitung der sogenannten Diesel-Verfahren ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Assistenzsystem eingeführt worden. Dazu wurde in der ersten Jahreshälfte ein Prototyp erprobt, der nach weiteren Entwicklungsschritten nun den 17 Richterinnen und Richtern in vier Zivilsenaten zur Verfügung steht, die für Berufungen und Beschwerden in „Diesel-Klagen“ im Rahmen des sogenannten Abgasskandals zuständig sind. In Baden-Württemberg ist der Einsatz digitaler Assistenzsysteme möglich, weil die elektronische Akte bereits zum Arbeitsalltag in den Gerichten gehört.
Justizministerin Marion Gentges sagte: „Bei der Einführung der elektronischen Akte in den Gerichten und Justizbehörden nimmt Baden-Württemberg bundesweit bereits die Vorreiterrolle ein. An diesem Punkt bleiben wir aber nicht stehen. In einer zweiten Digitalisierungswelle müssen wir die Justiz auch mit intelligenten Assistenzsystemen ausstatten. Damit haben wir bereits begonnen. In Zukunft kann ein neu entwickeltes Künstliche-Intelligenz-System Richterinnen und Richter bei der Bearbeitung der Diesel-Klagewelle unterstützen.“
Systematisierung der Akten nach wiederkehrenden Merkmalen
Am Oberlandesgericht Stuttgart sind aktuell 13.384 Diesel-Verfahren anhängig (Stichtag 30. September 2022). Monatlich waren zuletzt rund 600 Eingänge zu verzeichnen. Diese Fälle lassen sich anhand bestimmter Merkmale Fallgruppen zuordnen. Die entscheidenden Eckdaten aus den oft mehr als hundert Seiten umfassenden Schriftsätzen zu extrahieren und so die jeweils gleichgelagerten Fälle aus dem vorliegenden Aktenbestand zu selektieren, ist manuell jedoch nur mit größtem Aufwand möglich.
An dieser Stelle komme das KI-System zum Einsatz, so Marion Gentges. „Das KI-System analysiert die elektronischen Verfahrensakten und ordnet solche mit gleichgelagerten Sachverhalten einander zu. Die Systematisierung nach immer wiederkehrenden Merkmalen ist eine schematische Tätigkeit, für die wir nicht die Energie der Richterinnen und Richter verschwenden dürfen. Deren Fokus muss darauf liegen, die Kategorisierungen zu überprüfen und dann sorgfältige Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen diese Arbeitsteilung: Das KI-System im Bereich der Assistenz – und nur hier – die Richterinnen und Richter bei der inhaltlichen Bearbeitung, Überprüfung und Entscheidung“, so Marion Gentges.
Wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Justiz
Perspektivisch ist eine Ausweitung des Projekts auf weitere mit der Aufarbeitung der Dieselthematik befassten Gerichte möglich. Das Projekt kann für künftige Massenverfahren eine Blaupause zur frühzeitigen und gelungenen digitalen Bewältigung darstellen und so einen wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Justiz bilden. Dabei treibt Baden-Württemberg den Einsatz dieser Zukunftstechnologie bundesweit federführend als Vorsitzland des zuständigen Themenkreises der Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz voran und sorgt maßgeblich dafür, dass länderübergreifende Standards entwickelt werden. KI-Anwendungen sollen einmal entwickelt und in der Justiz in ganz Deutschland eingesetzt werden können. Neben der Erprobung erster KI-Anwendungen für die Justiz, liegt der Fokus daher in der Erstellung einer bundesweiten Strategie zum KI-Einsatz sowie der Entwicklung der notwendigen Technologie für einen effizienten Einsatz von KI in der Justiz.
Bei Diesel-Klagen handelt es sich um Klagen von Fahrzeugbesitzern und Eigentümern gegen Automobilhersteller wegen der behaupteten Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen in den Abgasreinigungseinrichtungen von Dieselfahrzeugen. Grundsätzlich richtet sich die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes nach dem allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten. Dieser ist bei Gesellschaften am Sitz des Unternehmens. Das Landgericht Stuttgart ist daher bundesweit für alle Klagen gegen die Autobauer zuständig, deren Konzernzentralen in Stuttgart sitzen. Die beim Landgericht Stuttgart deutlich überproportionalen Verfahrenseingänge führen aufgrund der hohen Berufungsquote in Diesel-Verfahren auch zu einer besonderen Belastung des Oberlandesgerichts Stuttgart, das für Berufungen gegen die Entscheidungen des Landgerichts Stuttgart zuständig ist.