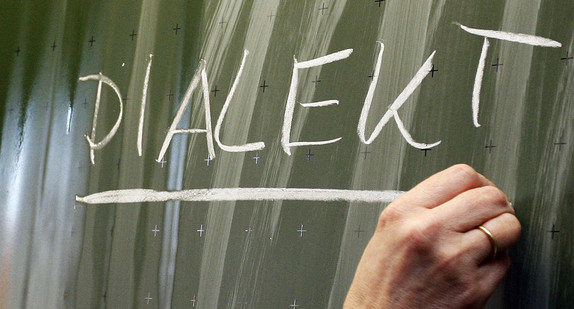Am Institut für Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg startet ein Forschungsprojekt zum Einsatz von Drohnen bei der Naturschutzarbeit. Untersucht werden technische Möglichkeiten, Einsatzfelder, Potentiale und Wirtschaftlichkeit.
Zum offiziellen Projektauftakt informiert sich der Amtschef im Umweltministerium, Ministerialdirektor Helmfried Meinel, über das neue Forschungsvorhaben „Drohnen im Biomonitoring: Technische Möglichkeiten – Einsatzfelder – Potentiale – Wirtschaftlichkeit – Geschäftsoptionen“ an der Hochschule für Forstwirtschaft (HFR) in Rottenburg.
Drohnen sollen Naturschutzarbeit erleichtern
In dem Forschungsprojekt wird die Hochschule für Forstwirtschaft mit Beteiligung des Instituts für Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg das Monitoring von ökologischen Fragestellungen mittels Drohnen untersuchen. Der Naturschutz erhält Unterstützung aus der Luft, denn Drohnen sollen künftig die Naturschutzarbeit erleichtern.
Das anwendungsorientierte Forschungsvorhaben wird von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg aus Erträgen der Glücksspirale über zwei Jahre mit 210.000 Euro gefördert. Monitoring, die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft, ist ein wichtiges Thema im Naturschutz und in der Biodiversitätsforschung. Denn wir wissen noch viel zu wenig über den Zustand unserer Natur.
Drohnen-Tests zu Methoden und Workflows
Drohnen sind – richtig eingesetzt – wertvolle Instrumente für Monitoringaufgaben. Testflüge zur Evaluierung unterschiedlicher Verfahren und Gerätetypen werden unter anderem in sensiblen Feuchtgebieten, in Felsenlandschafen und in komplexen Landschaften mit einem vielfältigen Struktur- und Nutzungsmosaik durchgeführt. Zum Einsatz kommen vor allem einfach bedienbare und praxiserprobte 'Drohnen' und Online-verfügbare Software, um deren Potential als nützliche und erschwingliche Werkzeuge für Feldökologen und die Naturschutzverwaltung zu ermitteln.
Wichtige Ziele des Forschungsvorhabens sind unter anderem das Testen von Methoden und Workflows zum Einsatz von Drohnen im Bio-Monitoring, das Aufzeigen von Möglichkeiten, mithilfe unterschiedlicher Sensoren das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern, die Bereitstellung von Informationen und Entscheidungshilfen sowie die Analyse von den Möglichkeiten und Vorteilen beim Einsatz neuartiger Fluggeräte.
Grenzen und Restriktionen von Drohneneinsätzen
Aber es werden nicht nur die Vorteile, sondern auch Grenzen und Restriktionen von Drohneneinsätzen im Rahmen des Projekts thematisiert und bei den Handlungsempfehlungen berücksichtigt. Denn Drohnen sind keine Universal-Werkzeuge, sondern können nur richtig angewandt Vorteile für die angedachten Aufgaben erbringen. Die Erkenntnisse des Projektes zur Arbeit mit Drohnen werden in einem Online-Handlungsleitfaden mit Empfehlungen und praktischen Anleitungen für Naturschutzaufgaben zusammengestellt.
Helmfried Meinel erläutert in seinem Grußwort, „dass es erstmalig ein Vorhaben auf dem Gebiet der angewandten Forschung in Baden-Württemberg gibt, dass den Einsatz von Drohen mit dem Naturschutz zusammenbringt. Der Einsatz von Drohnen ist ein innovativer, in ökologischer und hoffentlich auch ökonomischer Hinsicht zielführender Ansatz, um wertvolle Erkenntnisse für den Naturschutz und für das Biomonitoring im Kontext der Biodiversitätsforschung zu gewinnen.“ Prof. Dr. Dr. hc. Bastian Kaiser, Rektor der HFR, erwähnt in seinem Grußwort, „dass an der Hochschule damit ein weiteres hoch interessantes und innovatives Forschungsprojekt zum Einsatz von Drohnen in der Umweltforschung gefördert wird.“ Prof. Dr. Rainer Luick, der Projektleiter, betont, „dass mit Drohnen neue und bisher so nicht mögliche Daten zu ökologischen Phänomenen gewonnen werden können. Es werden in dem Projekt aber auch intensiv die Grenzen und Restriktionen thematisiert, dazu gehören auch eventuell ausgelöste Störungen.“
Prof. Dr. Rainer Luick
Professur für Natur- und Umweltschutz
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Tel.: 07472 951 238
E-Mail: luick@hs-rottenburg.de
Steffen Döring
Projektkoordinator „DroBio“
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Mobil: 0151 5354 9529
E-Mail: doering@hs-rottenburg.de
Quelle:
Umweltministerium, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg