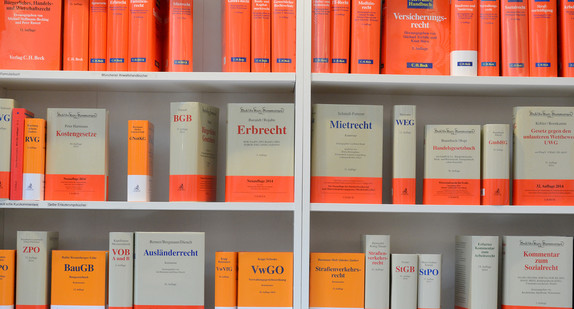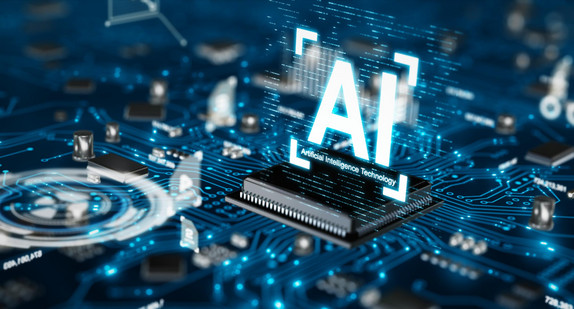Bis die Wahrheit ihre Schuhe angezogen hat, ist die Lüge schon drei Mal um die Welt gelaufen. Mit dem Internet ist es heute einfacher als jemals zuvor, Lügen, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Bevor das Internet zum Massenmedium wurde, waren Zeitungen, Radio und Fernsehen die Informationsquelle Nummer eins. Dort arbeiten in der Regel Journalistinnen und Journalisten, die sich an berufliche Standards wie in Deutschland den Pressekodex gebunden fühlen.
Außerdem gibt es eine soziale und gesellschaftliche Kontrolle der klassischen Medien. Zwar gibt es immer wieder Fälle von Journalistinnen und Journalisten, die falsch berichten oder sich Geschichten ausdenken – wie beispielsweise der Fall des damaligen Spiegel-Redakteurs Claas Relotius – doch am Ende fliegt es eigentlich immer auf und die Medienhäuser ziehen entsprechende Konsequenzen.
Das Internet dagegen ist ein Sprachrohr für jedermann. Jeder kann mit wenigen Klicks eine eigene Webseite erstellen oder einen YouTube-Kanal anlegen und dort publizieren. Dadurch ist die Meinungs- und die Nachrichtenvielfalt deutlich gestiegen. Viele YouTuber*innen, Blogger*innen und freie Journalist*innen nutzen das Internet, um über ihre Themen zu berichten. Viele halten sich dabei an die gängigen journalistischen Standards.
Wer profitiert von „Fake News“?
Es gibt aber auch Seiten und Kanäle im Netz, die nicht viel von diesen Standards halten und eine ganz eigene Agenda verfolgen. Dies passiert aus unterschiedlichen Motiven. Die einen wollen einfach nur mit vielen Klicks Geld verdienen, die anderen wollen politisch desinformieren und wieder andere sind einfach von ihrer Sicht der Welt überzeugt. Mit seriösem Journalismus haben aber alle nichts zu tun.
In Bezug auf Nachrichten bedeutet das, dass die Nutzerinnen und Nutzer ob der Fülle an Informationen und Nachrichten im Netz nicht mehr sicher sein können, welcher Information man vertrauen kann. So kommt es, dass man auf „Fake News“ hereinfällt oder zumindest unsicher ist, ob es sich um „Fake News“, Satire oder eine echte Nachricht handelt.
Was sind „Fake News“ und welche Arten gibt es?
„Fake“ bedeutet falsch und „news“ Nachricht. „Fake News“ sind also nichts anderes als Nachrichten, die absichtlich gefälscht sind. Das beschränkt sich aber nicht nur auf Texte, auch gefälschte oder manipulierte Bilder und Videos kursieren im Netz. Ein weiteres Mittel ist echte Texte und Bilder in einen falschen Kontext zu setzen und so die eigentliche Aussage des Originals zu verfälschen. Oder man zieht aus Fakten bewusst oder unbewusst falsche Schlussfolgerungen. „Fake News“ gibt es in verschiedener Intensität. Laut dem Massachusetts Institute of Technolgoy (MIT) lassen sich drei Stufen unterscheiden.
- Stufe 1: Nachrichten, die einem unwichtigen oder kleineren Aspekt extreme Aufmerksamkeit widmen
- Stufe 2: Propaganda
- Stufe 3: Gezielte Desinformation
Auch der Begriff „Fake News“ ist vor einer Umdeutung nicht gefeit, wenn Personen des öffentlichen Lebens seriöse Berichterstattung versuchen, mit dem Begriff „Fake News“ zu diskreditieren oder die Medien allgemein als „Lügenpresse“ bezeichnen.
Meinungsmache und Manipulation
Es gibt Interessensgruppen, die es sich zu Nutze machen, dass „Fake News“ nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen sind. Gefälschte Nachrichten gehen oft mit reißerischen Überschriften und Bildern einher, die Nutzerinnen und Nutzer auf einer emotionalen Ebenen ansprechen sollen. So werden Menschen dazu bewegt, auf einen bestimmten Artikel zu klicken und ihre Meinung im Sinne des Artikels zu beeinflussen. Dabei nutzen die Absender von solchen Nachrichten die Mechanismen von sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram, TikTok oder Facebook. Nutzerinnen und Nutzer neigen dazu, besonders emotionale oder skandalöse Nachrichten zu liken und zu teilen. Damit tragen sie zur Verbreitung der Nachricht bei. Die echte Nachricht, die Richtigstellung oder der Faktencheck erreichen dagegen selten diese Emotionalität und damit deutlich weniger Verbreitung.
„Fake News“ erkennen und sich schützen
Sich vor „Fake News“ zu schützen, liegt im eigenen Interesse. Denn besonders in Bezug auf politische Entscheidungen hat die eigene Meinungsbildung oberste Priorität. Doch es ist gar nicht so einfach, „Fake News“ immer sofort zu erkennen. Gerade auch, weil man im Internet die Fülle von Informationen mit den Augen eher überfliegt, statt wie in einem Buch jede Zeile zu lesen.
Es kann nicht schaden, sich generell mit einem gesunden Misstrauen in den sozialen Medien zu bewegen. Reißerische Schlagzeilen und Bilder können ein Indiz sein, ebenso wie die fehlende Angabe von Quellen. Hinterfragen Sie, wenn viele Zahlen, Daten und Fakten ohne seriöse Quellenangabe in einem Text vorkommen. Überprüfen Sie beim Lesen, ob der Text neutral geschrieben ist oder eher eine Meinung widerspiegelt. Wenn der Text als Kommentar geschrieben ist, hinterfragen Sie, ob es eine ausgewogene Meinungsvielfalt gibt. Wenn Sie auf eine Ihnen unbekannte Webseite weitergeleitet wurden, überprüfen Sie, ob es ein Impressum gibt und wer dort genannt wird – auch wenn diese eine seriöse Optik hat. Auch Werbung für unseriöse Produkte kommt manchmal ziemlich dreist daher. Da wird die Optik seriöser Nachrichtenseiten kopiert, um das Wunderprodukt in Form eines vermeintlich journalistischen Artikels anzupreisen. Schauen Sie in solchen Fällen also besser zweimal hin.
„Fake News“ regulieren
Das Problem „Fake News“ in den Griff zu bekommen, ist für die Betreiber sozialer Medien schwer. Automatisierte Algorithmen können nur schwer die Unterschiede zwischen Fakt und Realität in der Sprache herausfiltern – bei Satire versagen sie komplett. Auch mit Nutzerinnen und Nutzern, die solche Beiträge melden können, gibt es ein Problem, weil nicht klar ist, aus welchen Gründen der Nutzer dies meldet. Es ist davon auszugehen, dass das Phänomen auch in den kommenden Jahren stärker in den Sozialen Medien werden könnte – vor allem in Krisen- und Wahlkampfzeiten.
Falschmeldung/Ente: Als Ente oder Zeitungsente bezeichnet man eine Falschmeldung. In der Regel handelt es sich hier um unbeabsichtigte Irrtümer seitens der Redaktion, die in einer der folgenden Ausgaben mit einer Richtigstellung korrigiert werden.
Framing: Framing, zu Deutsch rahmen, beschreibt den Effekt der Meinungsveränderung, wenn Medien bei der Berichterstattung über Themen und Ereignisse bestimmte Aspekte weglassen oder besonders betonen. So wird eine bestimmte Interpretation oder Deutungsrahmen eines Themas vorgegeben, die nachgewiesenermaßen vom Publikum häufig übernommen wird.
Glosse: Glossen findet man in der Regel in den Randspalten von Zeitungen. Darin äußert ein Redakteur seine eigene Ansicht zu einem aktuellen Thema. Wichtigstes Merkmal einer Glosse ist eine ironische oder sogar satirische Darstellungsweise. Glossen werden in seriösen Medien immer als solche gekennzeichnet.
Kommentar: In einem Kommentar drückt der Redakteur seine eigene Meinung zu einem Sachverhalt aus. Anders als in der Glosse geht es hier nicht um eine ironische Präsentation, sondern darum einen weiteren Aspekt oder Blickwinkel hinzuzufügen, der dem Autor wichtig ist. Häufig wird hier ein Bild des Redakteurs oder der Redakteurin zum Text abgebildet. Kommentare werden in seriösen Medien immer als solche gekennzeichnet.
Lügenpresse: Der Begriff „Lügenpresse“ wird seit Beginn des 19. Jahrhunderts verwendet. Aktuell wird er vor allem von der politischen Rechten in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Medien benutzt. Er wirft bewusste Falschmeldung vor, die das eigene Lager diskreditieren. 2014 wurde der Begriff zum „Unwort des Jahres“ erklärt.
Meinung: Einige Medien nutzen statt den Begriffen Glosse oder Kommentar auch den Begriff Meinung, um deutlich zu machen, dass es sich hier um die Meinung der/des Autorin/Autors handelt.
Meldung: Eine Meldung ist eine Kurznachricht, die sich an die Öffentlichkeit richtet mit Informationen, die die journalistischen W-Fragen, also Wer, Was, Wo, Wann und Warum beantworten. Sie sind eine neutrale Darstellung von realen Ereignissen.
Priming: Das Priming, zu Deutsch primär, ist ein Begriff aus der Psychologie, der als Medien-Priming in die Kommunikationsforschung übernommen wurde. Priming geht davon aus, dass unser Gehirn Information besser und leichter verarbeiten kann, wenn es mit der gleichen Assoziation verknüpft ist. In Bezug auf Massenmedien besagt der Effekt, dass Medienkonsumenten spezifische politische Akteure bevorzugt nach denjenigen Kriterien beurteilen, die in der allgemeinen Medienberichterstattung verstärkt thematisiert wurden.
Richtigstellung: Wird die Wahrheit in einem öffentlichen Medium verletzt, kann der Betroffene eine Richtigstellung fordern. Diese wird in einer der kommenden Ausgaben veröffentlicht. Wenn Persönlichkeitsrechte betroffen sind, kann das Medium dazu verpflichtet werden eine Gegendarstellung, also eine Stellungnahme des Betroffenen, zu publizieren.
Satire: Die Satire ist eine Kunstform, die Personen, Ereignisse oder Zustände kritisiert. Sie nimmt dabei meist Bezug auf reale Geschehnisse und spitzt dabei humoristisch zu. Dazu nutzt sie sowohl Übertreibung als Überhöhung oder Untertreibung als bewusste Bagatellisierung. Dabei geht es auch ins Lächerliche und Absurde. Satire richtet sich oft von unten nach oben. Also Bürgerempfinden gegen Repräsentanzen der Macht. In Deutschland sind etwa das Online-Magazin „Der Postillon“ oder die Fernsehsendungen „heute show“ (ZDF) und „Extra3“ (NDR) die bekanntesten Satireformate. Satirische Formate sind aber auch in Nachrichtenmedien zu finden – dort wird der Beitrag dann aber in der Regel als solcher gekennzeichnet.
Faktenfuchs, der Faktencheck des Bayerischen Rundfunks
Correctiv.org: FakeNews, Lügenpresse und was wir tun können
Faktencheck der internationalen Nachrichtenagentur AFP (Deutsch)
Faktencheck der österreichischen Nachrichtenagentur APA
Faktencheck der internationalen Nachrichtenagentur AFP (Englisch)
Faktencheck der internationalen Nachrichtenagentur Reuters (Englisch)