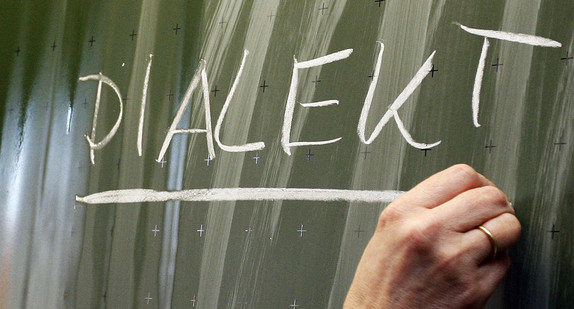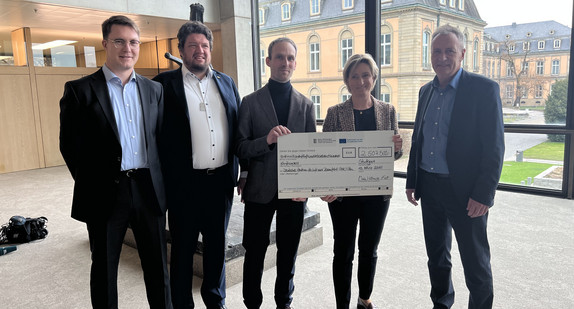Die Bewältigung des Klimawandels, die Digitalisierung und geopolitische Entwicklungen führen zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationen. Die Landesregierung begleitet diese Transformationsprozesse durch verschiedene Dialogformate. Drei große Dialoge zwischen Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft sind der Strategiedialog Automobilwirtschaft, das Forum Gesundheitsstandort und der Strategiedialog "Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen".
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Luft- und Raumfahrtstrategie. Unter dem Motto „THE Aerospace LÄND“ werden für die Vision einer digitalen, klimafreundlichen sowie kooperativen Luft- und Raumfahrt ressortübergreifend baden-württembergische Forschungsaktivitäten und Initiativen gebündelt.
Damit der Wechsel von Studium und Wissenschaft ins eigene Unternehmen einfacher wird, fördert das Land eine positive Gründungskultur an den Hochschulen – mit dem Ziel, ein ganzheitliches und landesweites Gründungs-Ökosystem zu entwickeln. So gelangen wissenschaftliche Erkenntnisse als technologische, aber auch als soziale Innovationen in die Praxis und tragen dazu bei, dass Baden-Württemberg dauerhaft ein starker Wirtschaftsstandort bleibt.
Das neue Förderformat des Wissenschafts- und Wirtschaftsministeriums „Prototypenförderung für innovative Technologien“ unterstützt Forschende aus Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen dabei, mögliche Anwendungsbereiche für ihre Forschungsergebnisse zu erschließen. Zentrales Ziel dieses Förderformats ist, das Innovationspotenzial von Forschungsergebnissen durch den Bau von funktionsfähigen Prototypen nachzuweisen und mögliche Verwertungsbereiche zu erschließen – unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen und ethischen Rahmenbedingung sowie der Akzeptanz des Marktes und der Gesellschaft.
Die Erfolge der baden-württembergischen Universitäten in der bundesweiten Exzellenzstrategie haben bewiesen, wie hoch die Qualität der Wissenschaft im Land ist. In der aktuellen Runde der Exzellenzstrategie ist Baden-Württemberg das erfolgreichste Land, das mit den Universitäten Heidelberg, Konstanz, Tübingen und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vier der bundesweit elf Exzellenzuniversitäten vorweisen kann. In Baden-Württemberg werden mit 12 Exzellenzclustern 21 Prozent der insgesamt bundesweit 57 Exzellenzcluster gefördert.
Das Land steht hinter seinen starken Universitäten und unterstützt sie sowohl finanziell als auch konzeptionell im bundesweiten Wettbewerb für die nächste Förderrunde ab 2026. Besonders qualifizierte wissenschaftliche und künstlerische Nachwuchskräfte erhalten im Rahmen der Landesgraduiertenförderung Unterstützung für ihr Promotionsvorhaben. Die ergriffenen Maßnahmen dienen dazu, die Transparenz und Qualität in Promotionsverfahren zu stärken, die Betreuung der Promovierenden zu verbessern und ihnen eine starke Stimme an den Hochschulen zu geben.
Baden-Württemberg soll Nummer eins der europäischen Forschungsregionen bleiben. Daher fördert die Landesregierung herausragende Spitzenforschung an unseren Universitäten konsequent und unterstützt insbesondere Kooperationen von Universitäten mit Instituten der Max-Planck-, der Leibniz- und der Fraunhofer Gesellschaft sowie der Helmholtz-Gemeinschaft. Ebenso wird die Teilnahme baden-württembergischer Forschungseinrichtungen an europäischen Projekten unterstützt.
Baden-Württemberg ist sehr erfolgreich bei der Einwerbung von EU-Mitteln für Forschung und Innovation. Laut aktuellen Auswertungen sind baden-württembergische Hochschulen mit 296 Beteiligungen und rund 202,8 Millionen Euro eingeworbenen EU-Zuwendungen im Bundeslandvergleich führend (Datenstand: März 2023). Im auslaufenden EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014–2020) beträgt die Höhe der EU-Zuwendungen für Einrichtungen aus Baden-Württemberg insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro (Datenstand: Juni 2022). Auch die vielen und intensiven Forschungskooperationen mit unseren Nachbarn in Frankreich und der Schweiz stärken den Forschungsstandort weiter.
Die Innovationscampus-Modelle bündeln die Stärken von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vor Ort und generieren einen Mehrwert für das ganze Land. Folgende Innovationscampus-Modelle fördert die Landesregierung:
- Cyber Valley zur "Künstlichen Intelligenz" in Tübingen, Stuttgart und Karlsruhe
- "Mobilität der Zukunft" in Karlsruhe und Stuttgart
- "Lebenswissenschaften und Gesundheitsforschung" in der Rhein-Neckar-Region
- "QuantumBW" mit Akteuren aus ganz Baden-Württemberg
- „Nachhaltigkeit“ in Freiburg und Karlsruhe
Mit dem Innovationscampus Cyber Valley findet die Künstliche Intelligenz ein Zentrum in Baden-Württemberg. Mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft ist eine der größten Forschungskooperationen für Intelligente Systeme in Europa mit internationaler Strahlkraft entstanden. Das Land Baden-Württemberg investiert in den kommenden Jahren 60 Millionen Euro. Schon seit Jahren stellt die Landesstrategie für High Performance Computing (HPC) sicher, dass die Wissenschaft in Baden-Württemberg mit einer exzellenten Forschungsinfrastruktur ausgestattet ist. Sie wird bis 2032 fortgeschrieben und weiterentwickelt, um die Vorreiterrolle und internationale Spitzenposition des Landes im Supercomputing zu erhalten und auszubauen. Bundesweit ist sie die einzige Landesstrategie, die alle Ebenen der HPC-Leistungspyramide - europäisch/national, national/überregional, landesweit/regional - umfasst, sodass sie wiederholt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als „beispielgebend und innovativ“ bewertet wurde. Baden-Württemberg ist damit bundesweit führend unter den Bundesländern.
Der Innovationscampus „Mobilität der Zukunft“ wird zu einem europäischen Zentrum für die Forschung und Entwicklung in den Schwerpunkten emissionsfreie Mobilität und Software-defined Engineering/smarter Maschinenbau ausgebaut. Seit 2019 fördert Baden-Württemberg dieses Vorhaben mit über 65 Millionen Euro und leistet damit einen Beitrag für die nachhaltige und digitalisierte Mobilität der Zukunft.
Der Innovationscampus „Health and Life Science Alliance Heidelberg Mannheim“ bündelt die Gesundheits- und Lebenswissenschaften der international renommierten Forschungseinrichtungen sowie der Universitätsmedizin in der Region Rhein-Neckar zu einem international sichtbaren Hotspot. Wissenschaftliche Erkenntnisse gelangen durch die Zusammenarbeit der Disziplinen schneller in die medizinische Anwendung – zum Nutzen der Gesellschaft und auch der Gesundheitswirtschaft im Land. Über den Innovationscampus hinaus hat das Land das Ziel, den landesweiten Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW zu einer Erfolgsgeschichte machen. Mit dem Forum Gesundheitsstandort bringt Baden-Württemberg technologische und medizinische Innovationen weiter voran und stärkt die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft.
Um Kompetenzen von Akteure beim Thema Quantenwissenschaften zu bündeln, aus Forschungsergebnissen marktreife Produkte zu entwickeln und unseren Standort international sichtbarer zu machen, hat die Landesregierung im April 2023 – gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft – den Innovationscampus QuantumBW gegründet. Dessen strategische Zielsetzungen und Handlungsfelder wurden in der baden-württembergischen Quantenstrategie zusammengefasst und veröffentlicht. Mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat das Land gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung die deutschlandweit größte Forschungs- und Lehreinrichtung geschaffen. Das KIT ist als „die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft“ sowohl Universität des Landes als auch nationales Großforschungszentrum mit den Aufgaben Forschung, Lehre und Innovation. Durch eine weitere Stärkung seiner Autonomie und seiner Handlungsspielräume bei Personal, Budget und Bau trägt das Land dieser bundesweit einzigartigen Struktur Rechnung.
Der 2024 gestartete Innovationscampus Nachhaltigkeit (ICN) an der Universität Freiburg und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) soll die Oberrheinregion als international sichtbaren Wissenschaftsstandort in der Nachhaltigkeitsforschung gezielt weiterentwickeln. Ziel sind Innovationssprünge in der Stadtplanung, im Ernährungssystem oder bei der Ressourcenwende hin zu erneuerbaren Energien. Dabei arbeiten die Forschenden eng mit Partnern aus Gesellschaft, Wirtschaft und mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen.
Wissenschaft und Forschung brauchen Freiräume, in denen neue Ideen entstehen und umgesetzt werden können. Verlässliche Rahmenbedingungen geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihren eigenen Projekten nachzugehen. Um risikoreiche Forschung ausdrücklich zu unterstützen, haben wir den mit 30.000 Euro dotierten Preis für mutige Wissenschaft initiiert. Diese bundesweit erstmalige Auszeichnung würdigt außergewöhnliche Forscherpersönlichkeiten, die neue Wege einschlagen.
Wissenschaftskommunikation ist elementar für die Krisenfestigkeit einer Gesellschaft. Deshalb stärkt die Landesregierung die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft. Zu gesellschaftlich bedeutenden Themen wurden neue Projekte aufgelegt und fortgeführt. Dazu gehören auch die Dokumentationsstelle Rechtsextremismus sowie die universitäre Forschungsstelle „Rechtsextremismus“, die im Mai 2023 als eigenes Institut für Rechtsextremismusforschung an der Universität Tübingen gegründet wurde.
Im Rahmen der „Landesinitiative Kleine Fächer in Baden-Württemberg“ entwickelt das Wissenschaftsministerium seit 2015 Maßnahmen, die einerseits die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Kleinen Fächer in Lehre und Forschung erhöhen und andererseits den Transfer ihrer Forschungsergebnisse in die Gesellschaft fördern.
Die Landesregierung entwickelt die Forschungs- und Hochschulpolitik im Dialog mit Einrichtungen sowie mit einschlägigen Netzwerkstrukturen weiter: Im Jahr 2022 hat das Land den Dialogprozess „Zukunftslabor Hochschulen in der digitalen Welt“ gestartet, mit dem unter anderem ein Austausch über die Erfahrungen aus der Pandemie und über damit verbundene Zukunftsfragen angestoßen wurde. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie kann die Digitalisierung in den Hochschulen auf allen Ebenen in Forschung, Lehre und Administration gleichermaßen verankert, umgesetzt und nachhaltig vorangetrieben werden? In diesen Prozess wurden Beteiligte wie Hochschulleitungen, Studierende, Lehrende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Mitarbeitende aus der Verwaltung einbezogen. Gemeinsam sind hochschulartenübergreifende Maßnahmen erarbeitet worden, um die Digitalisierung der Hochschulen ganzheitlich voranzubringen und nachhaltig zu stärken.
Mit Reallaboren fördert das Land eine neue Form des wechselseitigen Wissenstransfers. Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen des Landes greifen hier in Kooperation mit lokalen Akteuren aus der Zivilgesellschaft Themen wie Mobilität, Stadtentwicklung oder Künstliche Intelligenz auf. Für die Förderung von Reallaboren hat das Land seit 2015 rund 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Aus den Förderlinien „Reallabor Klima“ und „Reallabore Künstliche Intelligenz“ erhalten die erfolgreichsten vier Wettbewerber zu den Themen Künstliche Intelligenz, Mobilität und Klima bis 2026 eine Anschlussförderung von insgesamt rund 3 Millionen Euro.